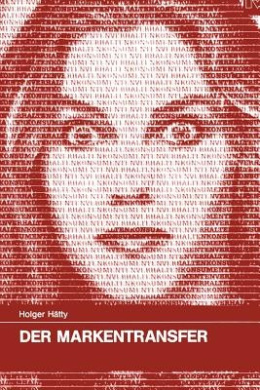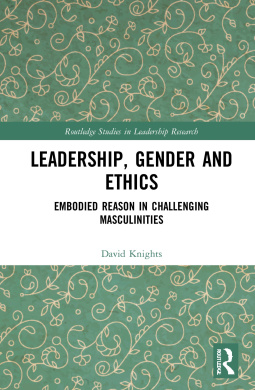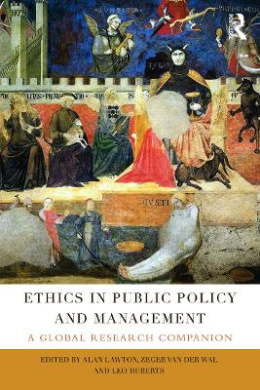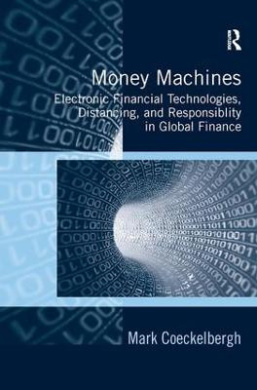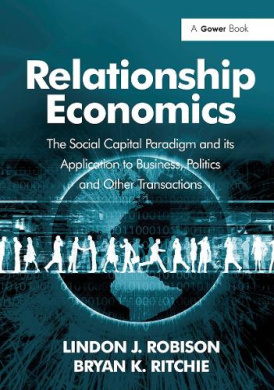Description
Eine Vielzahl von Transferbeispielen belegt das in jngster Zeit stark gestiegene Interesse am Markentransfer, also der bertragung bekannter und eingefhrter Markennamen auf neue Produktbereiche. Demgegenber stehen eine Vielzahl gescheiterter Transferversuche und die Kasandrarufe profilierter Markentechniker, sei es, da sie am Erfolgspotential von Markentransfermanahmen zweifeln, schlimmer jedoch, da sie negative Auswirkungen auf die Marke befrchten. Der Autor hat die bislang umfassendste Gesamtabhandlung zu dem Thema vorgelegt. Ausgehend von fundierten theoretisch-wissenschaftlichen Betrachtungen und einer kritischen Analyse der bisherigen Lsungsanstze wird auf der Grundlage einer realittsnahen experimentellen Untersuchungsanlage und weiterfhrender subtiler theoretischer Analyse ein operationales und praxisnahes Modell zur Bestimmung des Transferpotentials von Marken entwickelt. Durch die Analyse von Paneldaten wird darber hinaus erstmals die konomische Erfolgstrchtigkeit von Markentransfermanahmen quantitativ berprft. Gesttzt auf eine qualitative Expertenbefragung und eine Vielzahl von Fallbeispielen werden konkrete Hinweise fr eine praktische Umsetzbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse gegeben. Die differenzierte, gleichzeitig aber praxisnahe Darstellung vermittelt jedem Entscheidungstrger eine Vielzahl wertvoller Einsichten und lt die groe Sensibilitt des Verfassers fr markenpolitische Fragestellungen erkennen. Einfhrung.- 1: Grundlagen des Markentransfers.- A. Absatzwirtschaftliche Aspekte des Markentransfers 5.- I. Der Begriff der Marke.- 1. Die Marke unter formalem Aspekt.- 2. Die Marke unter inhaltlichem Aspekt.- 2.1. Die Marke als Kommunikationsinstrument.- 2.2. Wirkungsstufen der Marke.- 2.2.1. Der Markenartikel.- 2.2.1.1. Angebotsorientierte Anstze der Wesensbestimmung.- 2.2.1.2. Nachfrageorientierte Anstze der Wesensbestimmung.- 2.2.2. Die Markenware.- II. Wesen und Begriff des Markentransfers.- 1. Stellenwert und Bedeutung von Markierungsentscheidungen.- 2. Grundstzliche Markierungsstrategien.- 3. Wesen des Markentransfers im weiteren Sinn.- 3.1. Erforderlicher Grad des Markierungstransfers.- 3.1.1. bertragung des Markenzeichens.- 3.1.2 bertragung der Ausstattung.- 3.2. Transferbeteiligte Unternehmen.- 4. Wesen des Markentransfers im engeren Sinn.- 4.1. Zugrundeliegende produktpolitische Aktivitt.- 4.2. konomische Zielsetzung.- 5. Diskussion alternativer Begriffsfassungen und -inhalte.- 5.1. Imagetransfer.- 5.2. Markendiversifikation.- 5.3. Line extension.- 5.4. Brand extension.- 5.5. Licensing.- 5.6. Sonstige Begriffsfassungen.- 6. Begriffsabgrenzungen.- 6.1. Franchising.- 6.2. Corporate Identity.- 7. Zusammenfassung und abschlieende Begriffsfassung.- B. Rechtliche Aspekte des Markentransfers.- I. Grundlagen des Warenzeichenrechts.- II. Rechtsfolgen unterschiedlicher Formen des Markentransfers.- 1. Identitt von Markenrechtsinhaber und Markennutzer.- 1.1. Im Warenverzeichnis bereits gefhrte Transferprodukte.- 1.2. Im Warenverzeichnis noch nicht gefhrte Transferprodukte.- 2. Nicht-Identitt von Markenrechtsinhaber und Markennutzer.- 2.1. Im Warenverzeichnis bereits gefhrte Transferprodukte.- 2.2. Im Warenverzeichnis noch nicht gefhrte Transferprodukte.- 2.2.1. Die Warenzeichenlizenz.- 2.2.1.1. Begriff.- 2.2.1.2. Rechtliche Wrdigung.- 2.2.2. Mgliche Markenrechtsinhaber im Transferproduktbereich.- 2.2.2.1. Der Lizenzgeber.- 2.2.2.2. Der Lizenznehmer.- III. Der Markentransfer als Manahme des Warenzeichenschutzes.- C. Psychologische Aspekte des Markentransfers.- I. Struktur und Elemente des psychologischen Erklrungsmodells.- II. Einstellungen und Images als intervenierende Variable.- 1. Die Einstellung.- 2. Das Image.- 2.1. konomisch und gestaltpsychologisch orientierte Imageanstze.- 2.2. Einstellungsorientierte Imageanstze.- 2.2.1. Denotationen und Konnotationen als wesensbestimmende Imagedimensionen.- 2.2.2. Das Image als Konnotationensystem.- 2.3. Fazit.- 3. Einstellungs- versus Imagetransfer.- 4. Die Prognoserelevanz von Einstellungen bzw. Images fr das tatschliche Kaufverhalten.- III. Lerntheoretische Grundlagen.- 1. Die Einstellungsbildung als Lernproze.- 2. Die Reizgeneralisation als lerntheoretische Erklrung des Einstellungstransfers.- 2.1. Der Begriff der Reizgeneralisation.- 2.2. Formen der Reizgeneralisation.- 2.2.1. Physikalische Generalisation..- 2.2.2. Phonetische Generalisation.- 2.2.3. Semantische Generalisation.- 3. Die Reizdiskrimination als kontrrer Vorgang der Reizgeneralisation.- 4. Der Erklrungsbeitrag der Reizgeneralisation als lernpsychologische Grundlage des Einstellungstransfers.- 4.1. Zur Bedeutung der lernpsychologischen Forschung fr den absatzwirtschaftlichen Bereich.- 4.2. Empirische Untersuchungen zur Existenz der Reizgeneralisation bei gleichmarkierten Produkten.- 4.2.1. Reaktionsmessung durch die Erfassung intervenierender Variablen.- 4.2.1.1. Die Studie von Kerby.- 4.2.1.2. Die Studie von Roman.- 4.2.2. Reaktionsmessung durch die Erfassung des direkt beobachtbaren Kaufverhaltens.- 4.3. Fazit.- IV. Wahrnehmungspsychologische Grundlagen.- 1. Der Zusammenhang zwischen Produktwahrnehmung und Produktbeurteilung.- 2. Die Einstellung als Determinante der Produktwahrnehmung.- 3. Produktbeurteilungsmechanismen.- 3.1. Die Attributdominanz.- 3.2. Der Halo-Effekt.- 3.3. Die Irradiation.- 2: Determinanten und Memglichkeiten des Transferpotentials von Marken.- A. Das Transferpotential 3. Grades.- I. Determinanten.- II Konsequenzen fehlenden Transferpotentials.- III. Erfassungsmglichkeiten.- B. Das Transferpotential 2. Grades.- I. Das Imagetransfermodell von Schweiger et al.- 1. Grundgedankendes Modells.- 2. Analyse des Meinstrumentes.- 2.1. Auswahl der Untersuchungsobjekte.- 2.2. Auswahl der Beurteilungskriterien.- 2.3. Rekonstruktion der Objektrume.- 2.3.1. Produktrume.- 2.3.1.1. Psychologischer Produktraum.- 2.3.1.2. Technologischer Produktraum.- 2.3.1.3. Abschlieende Bewertung.- 2.3.2. Produkt-Markenraum.- 3. Das Imagetransfermodell im berblick.- 4. berprfung der Transferhypothesen.- 5. Abschlieende Wrdigung des Imagetransfermodells.- 5.1. Theoretische Fundierung.- 5.2. Empirische Validitt.- 5.3. Fazit.- 6. Zur grundstzlichen Kritik an der Vorgehensweise.- II Das Markenimage als entscheidende Transferdeterminante.- 1. Zur Notwendigkeit und Problematik der Theoriebildung.- 2. Eine heuristische Leitstudie..- 2.1. Untersuchungsanlage.- 2.2. Untersuchungsergebnisse.- 2.2.1. Bekanntheit.- 2.2.2. Transferpotential.- 2.2.3. Einflufaktoren des Transferpotentials.- 2.3. Fazit.- 3. Die Bildung von Imagestrukturtypen auf der Grundlage eines semantischen Netzwerkmodells.- 3.1. Grundzge des Modells.- 3.2. Imagestrukturtypen.- 4. Anforderungskriterien an das Transferpotential von Marken.- 4.1. hnlichkeit der Teilnetzwerke von Stamm- und Transferprodukt.- 4.2. hnlichkeit von Bezugsebene und Objektebene bezglich des Transferproduktes.- 5. Produktgeprgte Markenimages.- 5.1. Determinanten.- 5.2. Konsequenzen fr das Transferpotential.- 5.2.1. Die konsumentenorientierte Produktklassendefinition als Bestimmungsfaktor des Transferpotentials.- 5.2.2. Die Auflsung einer starken Produkt-Markenbindung als unabdingbare Transfervoraussetzung.- 5.2.3. Imageprgnanz versus Imagestarrheit als Transrerdilemma.- 5.2.4. Objektiv-technische hnlichkeit versus funktionale Gebundenheit als Transferdilemma.- 5.2.5. Der Verwendungsverbund als Garant fr ausreichendes Transferpotential.- 6. Nutzengeprgte Markenimages.- 6.1. Wesen eines nutzengeprgten Markenimages.- 6.2. Konsequenzen fr das Transferpotential.- 6.3. Determinanten des Transferpotentials.- 6.3.1. Grundlagen.- 6.3.2. Nutzengeprgte Markenimages sachlich-funktionaler Ausrichtung.- 6.3.3. Nutzengeprgte Markenimages emotionaler Ausrichtung.- 6.3.3.1. Exklusivitt.- 6.3.3.2. Lebensstil.- 6.3.3.3. Design.- 6.3.3.4. Mode.- 6.3.3.5. Grenzen des Transferpotentials.- 7. Verwendergruppengeprgte Markenimages.- III. Mglichkeiten und Grenzen der Bestimmung geeigneter Transferprodukte.- 1. Die Messung der hnlichkeit zwischen Stamm- und Transferprodukt.- 2. Die Ermittlung des Markenimages als Ausgangspunkt fr die Bestimmung von Transferachsen.- C. Das Transferpotential 1. Grades.- I. Zur Operationalisierungsproblematik..- II. Empirische Analyse des Erfolgspotentials von Markentransfermanahmen.- III. Determinanten.- 1. Markenstrke.- 2. Innovationspotential des Transferproduktes.- 3. Diskriminierungsfhigkeit.- 3: Markenpolitische Aspekte.- A. Ziele des Markentransfers.- I. Reduktion von Markteintrittsbarrieren.- II. Anstreben von Marketingeffizienz.- III. Brand milking.- IV. Strkung der Marke.- V. Umgehung von Werbebeschrnkungen.- VI. Markenzeichenschutz.- B. Markenpolitische Umsetzung von Transfermanahmen.- I. Positionierung.- II. Produktpolitische Aspekte.- III. Werbepolitische Aspekte.- 1. Art des werblichen Auftritts.- 2. Allokation des Werbebudgets.- IV. Distributionspolitische Aspekte.- V. Preispolitische Aspekte.- VI. Besonderheiten bei der Warenzeichenlizenzvergabe.- C. Risiken des Markentransfers.- I. Konsequenzen nicht ausreichenden Transferpotentials.- II Konsequenzen nicht ausreichender Tragfhigkeit.